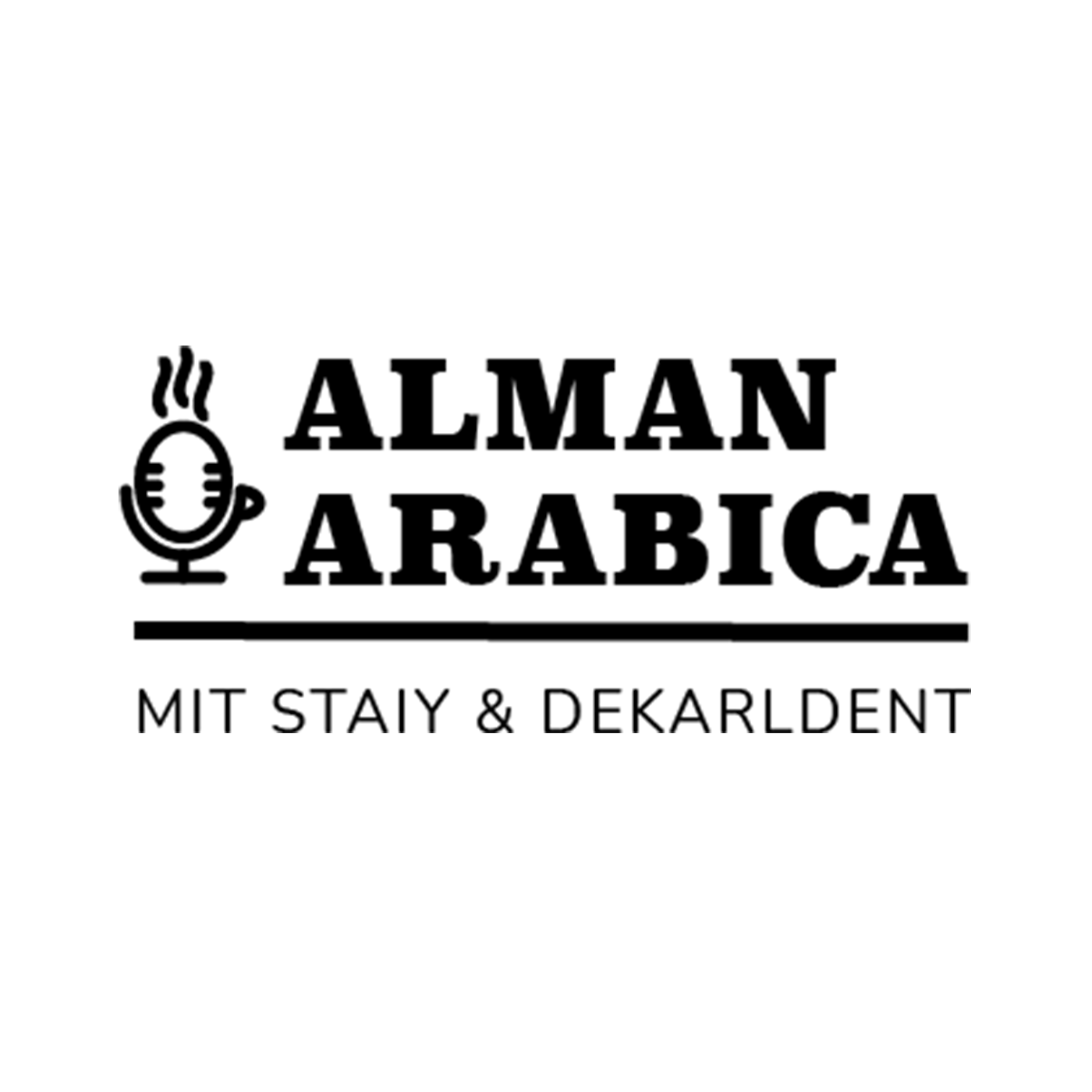Sand ins Hirn
Der Podcast liegt auf Eis. Von mir gibt es erst mal nichts neues, aber wenn Du mal ne Folge hochladen möchtest, ohne einen eigenen Podcast zu haben, schreib mir bei Instagram @Sand_ins_Hirn. Du machst die Folge fertig, schickst mir ein Bild, eine Beschreibung und natürlich die Folge und ich lade sie hoch! Das Thema ist dabei völlig egal, ob eine Person, zwei oder eine ganze Gruppe spielt auch keine Rolle. Tob Dich aus!
Ansonsten ist Sand ins Hirn – Der Podcast für unnützes Wissen & spannende Fakten
Du liebst kuriose Fakten, wissenschaftliche Aha-Momente und verblüffende Alltagsphänomene? Dann ist Sand ins Hirn dein perfekter Begleiter! In kurzen, unterhaltsamen Episoden erfährst du alles über ungewöhnliche Wissenschaft, psychologische Tricks, historische Irrtümer und mehr.
Ob Fluchen gut für die Gesundheit ist, warum unser Gehirn uns täuscht oder welche Verschwörungstheorien wirklich gefährlich sind – hier bekommst du Wissen, das hängen bleibt.
Hör rein! Perfekt für Wissensdurstige und Quiz-Liebhaber!
Impressum: https://www.mein.online-impressum.de/sand-ins-hirn/
Sand ins Hirn
#22 Rudi Dutschke | Der Mann, der BILD gefährlich wurde
Am 11. April 1968 wird auf den Studentenführer Rudi Dutschke ein Attentat verübt – drei Schüsse, die Deutschland erschüttern. In den Tagen danach brennen Springer-Lieferwagen, Tausende rufen: „BILD hat mitgeschossen!“
In dieser Folge von Sand ins Hirn geht es um die Macht der Worte, die Rolle des Springer-Verlags in der Eskalation und darum, wie ein mediales Klima zur Gefahr werden kann.
Wer war Rudi Dutschke? Warum wurde er zur Zielscheibe? Und was lernen wir aus der Geschichte für den Umgang mit Medien, Meinungsmacht und Sprache heute?
Mit historischen O-Tönen und einem Blick in die Vergangenheit, der aktueller nicht sein könnte.
O-Ton Quelle: https://www.dra.de/de/entdecken/akteure-der-bonner-republik/das-attentat-auf-rudi-dutschke
Videoempfehlung von @Topfvollgold: https://youtu.be/_Y4Ur5VvQUk
Social-Media:
TikTok @sand_ins_hirn:
https://www.tiktok.com/@sand_ins_hirn?_t=8q7ZbEU5IH3&_r=1
Instagram @sand_ins_hirn:
https://www.instagram.com/sand_ins_hirn/
YouTube @SandinsHirn:
https://www.youtube.com/@SandinsHirn
Am 11. April 1968 verlässt Rudi Dutschke seine Wohnung in Berlin. Er hat gerade einen Artikel fertiggestellt, will mit dem Fahrrad zur Post. Es ist ein milder Frühlingstag. Auf dem Kurfürstendamm nähert sich ein junger Mann mit einem Revolver. Drei Schüsse treffen Dutschke in den Kopf, in die Wange, in die Schulter. Der Attentäter flieht, wird wenig später gefasst in seinem Zimmer. Zeitungsausschnitte. Überschriften wie Stoppt Dutschke jetzt. Während Dutschke im Krankenhaus um sein Leben ringt, versammeln sich Tausende vor den Redaktionen des Springer Verlags. Zeitungswagen werden in Brand gesteckt, es fliegen Pflastersteine. Bild hat mitgeschossen, skandieren die Demonstranten. Es ist der Moment, in dem ein Kulturkampf eskaliert. Mit Worten, mit Gewalt. Was war geschehen? Wer war dieser Rudi Dutschke, der für einige Hoffnung, für andere Bedrohungen bedeutete? Welche Rolle spielte die Presse und insbesondere Bild der Eskalation? Und wie konnte ein Medienkonzern zum Ziel der größten Proteste der deutschen Nachkriegsgeschichte werdentenn? Der Podcast, um den Lernplatz in deinem Kopf zu füllen. Triviales Wissen präsentiert von David Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Sand ins Hirn Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer den Behind the Scenes Part der letzten Folge gehört hat, weiß, dass das ja relativ abrupt endete mit einer vagen Aussage über die Zukunft von santentiren. Ich hatte jetzt noch mal ein paar Wochen Zeit, mir darüber Gedanken zu machen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ein Jahr Sentenierenn für mich wirklich eine gute Laufzeit für dieses Projekt ist. Dies ist also die vorletzte Folge. Im August gibt es da noch eine reguläre letzte Folge und etwa eine Woche später kommt noch eine Folge, in der ich ein bisschen meine Gedanken zu diesem Projekt Revue passieren lasse. Und da erfahrt ihr auch, wie es vielleicht mit eurer Hilfe doch noch weitergeht. Aber dazu erzähle ich dann im August etwas mehr. Jetzt aber erst mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Rudi Dutschke. Also wer war das überhaupt? Rudi Dutschke wird 1940 in Schönefeld bei Berlin geboren. Aufgewachsen in der DDR kommt er bereits als Jugendlicher mit den Gedanken an soziale Gerechtigkeit in Berührung. Doch der autoritäre Charakter des SED Staats widerstrebt ihm. Kurz vor dem Mauerbau flieht er in den Westen. Er lässt sich in West Berlin nieder. Studiert Soziologie und wird Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SDS. Was Dutschke auszeichnet, ist seine Sprache. Er redet nicht in Parolen, sondern in Konzepten, in Gedankengebäuden. In einer Zeit, in der viele Studierende gegen Autoritäten rebellieren, ist Dutschke mehr als ein Aktivist. Er ist ein Denker und für viele ein Hoffnungsträger. Er glaubt an eine neue, demokratischere Gesellschaft, an eine Revolution der Bewusstseinsbildung. Gewalt lehnt er ab, zumindest im Inland. Die berühmte Idee vom langen Marsch durch die Institutionen stammt von ihm. Veränderung soll nicht durch Umstürze, sondern durch geduldige Arbeit von innen geschehen. Doch Dutschke polarisiert gerade, weil er nicht brüllt, sondern analysiert, weil er Kritik üben kann, ohne zu beleidigen, weil er in der Lage ist, Widersprüche aufzudecken in der Politik, in der Wirtschaft und in den Medien. Und anfangs habe ich ja schon den Springer Konnzern erwähnt. Also der Axel Springer Verlag war Ende der er Jahre das mediale Machtzentrum der Bundesrepublik. Bild, die auflagenstärkste Zeitung, erreichte täglich Millionen. Ihre Sprache war einfach emotional aggressiv, ihre politische Haltung konservativ, antikommunistisch, proameerikanisch und mit einem klaren Feindbild der linken Studentenszene. Zwischen 1966 und 1968 verschärfte sich die Tonlage. Studenten wurden als Terroristen, Krawallmacher und Staatsfeinde dargestellt. Dutschke wurde zur Symbolfigur stilisiert. Schlagzeilen wie Stopp. Dutschke jetzt. Oder Reädelsführer der roten Chaoten prägten das Bild. Dabei war Dutschke nicht gewalttätig, doch die Bild Zeitung stellte ihn als Gefahr dar. Es war keine sachliche Berichterstattung, sondern eine Stimmungskampagne. Bildschirte Angst vor dem Kommunismus, vor dem Umbruch, vor der Jugend ein. In einer Ausgabe aus dem Frühjahr 1968 titelte Jetzt reicht'schluss. Mit dem roten Terror. Der Artikel mischte dann unkommentiert Fotos von Demonstrationen mit Bildern brennender Mülltonnen. Der Eindruck war Hier ist Krieg und der Feind trägt Studentenmantel. Der Springerkonzern verstand sich dabei nicht als Verleger, sondern als Akteur im Meinungskampf. Axel Springer selbst sah seine Aufgabe darin, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu verteidigen mit publizistischen Mitteln. Kritiker werfen ihm vor, die Grenze zur Propaganda überschritten zu haben. Die redaktionellen Leitlinien seiner Blätter zielten nicht auf Vielfalt, sondern auf Eindeutigkeit. Und in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung war das brandgefährlich. Und für Dutschke wurde es halt besonders gefährlich, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe. Deswegen kommen wir jetzt auch zu dem Attentat. Am 11. April 1968 fährt Josef Bachmann nach Berlin. Er hat eine Waffe bei sich in seinem Gepäck Zeitungsausschnitte über Rudi Dutschke. Sein Ziel Dutschke töten. Bachmann war kein organisierter Rechtsextremist, aber er war empfänglich für das, was er las. In seinen Verhören sagte er spä Ich habe ihn wegen der Bild Zeitung erschossen. Sein psychisches Profil bleibt bis heute umstritten. War ein verwirrter Einzeltäter, ein ideologisch Aufgeladener, oder? Ja, sicher ist jedenfalls. Er war Teil eines gesellschaftlichen Klimas, in dem Gewalt gegen Linke nicht nur denkbar, sondern zunehmend salonfähig wurde. Doch das Attentat hat Dutschke halt knapp überlebt. Die Kugeln treffen ihn am Kopf, in der Schulter und im Gesicht. Wochenlang liegt er im Koma und es folgt monatelang Reha. Seine Sprache, sein Gedächtnis, alles ist beeinträchtigt. Doch Dutschke kämpft sich zurück. Für die Studentenbewegung ist das Attentat ein Schock. Doch es ist auch ein Wendepunkt, ein Punkt, an dem Worte zu Taten werden. Kommen wir nun zu dem Bild hat mitgeschossen. Noch in der Attentatsnacht versammeln sich Demonstranten vor dem Springerhohaus in Berlin. Parolen werden gerufen, Zeitungswagen angezündet, Bildha Mitgeschossen wird zum zentralen Slogan. Es folgen Tage des Protes. In mehreren Städten kommt es zu Ausschreitungen. Springer Auslieferungen werden blockiert, Zeitungen verbrannt, die Polizei reagiert mit Gewalt. Es ist eine Eskalation, wie sie die Bundesrepublik bis dahin kaum erlebt hat. In Hamburg, Frankfurt, München, überall wird demonstriert. Studentensprecher treten in Radiosendungen auf, erklären ihre Wut. Die Redaktionen von Bild werden mit Eiern, Steinen, Farbbeuteln beworfen. Vereinzelt kommt es zu Angriffen auf Journalisten. Damit ihr euch einen ungefähr einen Eindruck von den Protesten in Berlin machen könnt, habe ich ein paar Originalaufnahmen aus dem Deutschen Rundfunkarchiv für euch. Übertragen wurde das damals vom Rundfunk der DDR. Es folgt jetzt ein Ausschnitt der Sondersendung zum Attentat auf Rudi Dutschke vom 12.
>> Speaker B:April 1968##Hauses in Richtung Friedrichstraße. Ich wiederhole, verlassen Sie sofort den Vorplatz des Verlanghauses in Richtung Friedrichstraße.
>> Speaker C:Diese Aufforderung ergeht in dem Moment an die Demonstranten, als die übrigen 2000 Demonstranten, die zu Beuss den weiten Weg von dem Gebäude der Technischen Universität bis hierher die Kochstraße zurückgelegt haben, eingetroffen sind. Es mögen jetzt etwa drei bis vier Tan, vielleicht sogar 5000 junge Demonstranten sein, die hier vor dem Gebäude des Springer Verlagess stehen. Mit Fackeln und roten Fahnen in Sprechchören formulieren sie immer wieder ihren Protest gegen diese Zeitungen, gegen diesen Verlag. Die Scheiben hier am Verlagsgebäude an dem Eingangs Foyer sind fast alle Steinwölfe zerstört worden. Die Polizei hat mehrmals versucht mit brutaler Gewalt die Demonstranten von dem Eingang des Gebäudes fortzuhalten, doch bis jetzt ist nicht gelungen. Und in diesem Moment nun die Aufforderung der Polizei, die Straße hier die Kochstraße vor dem Gebäude ##DE zu räumen. Die Mannschaften der Polizei haben die Wasserwerfer bereits bestiegen und es ist damit zu rechnen, dass auch heute wieder die Polizei eben vom Wasserwerfereinsatz Gebrauch machen wird.
>> David:So und jetzt habe ich noch einen Ausschnitt für euch, mit dem deutlich wird, wie heftig es da auf den Straßen zugegangen zu sein scheint. Dieser ist aus der Sendung Pulsschlag der Zeit, ebenfalls vom 12. April 1968 und auch ebenfalls vom Rundfunk der DDR.
>> Speaker D:Die bewaffnete Macht des Regierenden Bürgermeisters tritt in diesem Augenblick in Aktion. Knüppelnde Polizisten, spritzende und schießende Wasserwerfer, die tausende von Liter Wasser auf die Demonstranten werfen. Es ist eine hektische Atmosphäre, ein Chaos. Und hier knüppelt die Polizei in SS Manier auf die Demonstranten, die hier heute gegen den Mordversuchen die Lutschke protestieren wollen.
>> Speaker E:Beiden Wasserwerfern fährt die Polizei jetzt brutal auf die Reihe der Demonstranten hinzu. Auch jetzt peitscht hier wieder der Wasserwerferstrahl über uns. Die Demonstranten fliehen einen Moment zurück, aber hinten stehen die weiter demonstrieren wollen dieen Sprechchören auf die Notstandsübung des Senats hinweisen. Eine Übung, die dieser Senat gewollt hat. Verzweifelt stemmen sich die Demonstranten gegen die Wasserwerfer, aber mit brutaler Gewalt fährt der Wasserwerfer der Polizei über Demonstranten hinweg. Sie fallen zu Boden. Aber die Polizei macht nicht Halt. Sie stürmt weiter voran, um hier mit Wasserwerfer strahlen und jetzt auch mit einer Vielzahl von Polizeiknüppeln hier auf die friedlich demonstrierenden Berliner einzuschlagen.
>> Speaker D:Das ist brutaler faschistischer Terror auf den Straßen West Berlins am Karfreitag des Jahres 1968. Das ist faschistischer Terror, der hier in Westber. Berlin von der Polizei unter Anführung des Regierenden Bürgermeisters verübt wird.
>> David:Ja, also das klingt ja schon ziemlich krass. Also die Wortwahl ist da schon sehr eindeutig, vor allem auch, wenn man sich anhört, wie hart die Polizei da damals gegen die Demonstrierenden vorgegangen zu sein scheint. Zu den O Tönen gibt es auch vom Rundfunkarchiv noch einen kurzen Artikel, der das Ganze noch mal ein bisschen einordnet. Lest euch das gerne noch mal durch. Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Neben den Protesten wurde auch zu einem bundesweiten Boykott der Springerpresse aufgerufen. Flugblätter mit dem Titel Enteignet Springer werden verteilt. Eine ganze Generation von Studierenden fühlt sich im Krieg nicht mit dem Staat, sondern mit dem mit einem Konzern, also mit dem Springer Konnzern in dem Fall. Und welche Rolle hatten denn die Medien in dem Ganzen? Also die Medien haben ja grundsätzlich Macht. Das zeigt sich in diesen Tagen überlich. Die Bild hatte nicht geschossen, aber sie hatte ein Feindbild geschaffen, einen Menschen zur Symbolfigur einer Bedrohung gemacht. Die Worte, die sie verwendeten, waren nicht neutral, sie waren aggressiv, sie wollten nicht informieren, sondern mobilisieren. Und sie trafen auf ein Publikum, das bereit war zuzuhören. Der Philosoph Jürgen Habermas sprach später von einer strukturellen Gewalt der Sprache. Wer Sprache einsetzt, um Feindbilder zu schaffen, übt Macht aus. Ä übt Macht aus. Nicht mit Waffen, sondern mit Wörtern. Die Gewalt je Rudi Dutschke traf, war physisch, aber sie war vorbereitet durch Worte, durch eine Sprache, die die Gewalt denkbar machte. Und das macht die Debatte um Springer so brisant, wie sagte Angela Merkel achtet auf die Sprache.
>> Speaker F:Denn die Sprache ist sozusagen die Vorform des Handelns. Und wenn die Sprache einmal auf die schiefe Bahn gekommen ist, kommt auch sehr schnell das Handeln auf die Schiefebahn. Und dann ist auch Gewalt nicht mehr fern. Und der sorgsame Umgang mit der Sprache ist jetzt sagen durch die Digitalisierung der sozialen Medien nicht gerade einfacher geworden. Und trotzdem sollte man genau deshalb auch mit den Worten sehr achtsam umgehen.
>> David:Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber was ist nach dem Attentat aus Dutschke geworden? Ja, er erholt sich über Jahre hinweg, seine Sprache bleibt beeinträchtigt, seine körperliche Gesundheit labil. Trotzdem bleibt er aktiv. Er zieht nach Dänemark, schreibt, denkt, diskutiert. Er bleibt Teil der Linken, kritisiert jedoch den Terror der RAF und setzt sich für gewaltfreie Reformen ein. 1979 stirbt Rudi Dutschke dann an den Spätfolgen des Attentats. Er erleidet einen epileptischen Anfall in der Badewanne, verursacht durch die Schädelverletzung, und er wird auch nur 39 Jahre alt. Doch seine Ideen leben weiter. Viele seiner Gedanken finden sich später in den Programmen der Grünen wieder, deren Mitgründung er inspirierte. Der Springer Verlag ist damals in die Defensive gegangen, erweist jede Verantwortung von sich. Axel Springer selbst erklärt, man habe lediglich Berichte berichtet, nicht gehetzt. Politiker wie Franz Josef Strauß stellen sich hinter den Verlag, doch nicht alle sehen das so. Auch innerhalb der Politik gibt es Kritik. Einige SPD Politiker werfen Bild gezielte Eskalation vor. Die Debatte um Medienmacht, Verantwortung und Pressefreiheit wird öffentlich geführt. Ein Untersuchungsausschuss wird gefordert, aber nie eingerichtet. Springer überlebt die Krise, doch sein Ruf in der linken Szene ist auf Jahrzehnte zerstört. In den folgenden Jahren entwickelt sich eine breite Medienkritik. Nicht nur Bild, auch andere große Häuser werden hinterfragt. Die Forderung nach einer pluralistischen Presselandschaft wird laut und in linken Kreisen entsteht ein neues Selbstverständnis gegen Springer, gegen Einheitsmeinung für kritischen Journalismus. Ja, was war das Echo davon in Popkultur, Erinnerungskultur und Mythos? Dutschke? Ja. Rudi Dutschke ist heute mehr als eine historische Figur. Er ist ein Symbol für einige, ein Held, für andere ein, ja, ich sag mal, Irritierender. In Songs, Theaterstücken und Filmen taucht seine Figur auf. Die Band Tonsteine Scherben besingt 1971 den Rudi als Revolutionär. In Berlin Kreuzberg wird eine Straße nach ihm benannt. Gedenktafeln erinnern an den Ort des Attentats. Gleichzeitig bleibt die Bewertung umstritten. War Dutschke ein Visionär oder ein Ideologe, ein Demokrat oder ein gefährlicher Radikaler? Die Erinnerung ist fragmentiert und gerade das macht sie spannend. In Schulen wird Dutschke heute unterrichtet als Teil derer Bewegung. Doch Seine Biografie ist mehr als Protestgeschichte. Sie ist ein Lehrstück über Sprache, Macht und Verantwortung. Ja, und welche Lehren können wir daraus für heute ziehen? Was sagt uns diese Geschichte heute in Zeiten sozialer Medien, digitaler Empörung und Fake News? Worte haben Macht und Medien tragen Verantwortung. Wer Menschen systematisch als Gefahr darstellt, bereitet den Boden für gewalt. Das war 1968 so und das gilt auch heute noch. Wenn politische Gegner zu Feinden gemacht werden, wenn Komplexität durch Schwarz Weiß Denken ersetzt wird, wenn Sprache hetzt, statt zu erklären, dann ist die Demokratie in Gefahr. Die Mechanismen von damals sind heute Globa Algorithmen ersetzen Redaktionen, Schlagzeilen werden durch Hashtags ersetzt. Und doch bleibt die zentrale Frage dieselbe. Welche Sprache benutzen wir und mit welchem Ziel. Ich habe zum Thema Bild und deren Berichterstattung noch eine spannende Videoempfehlung für euch. In diesem Video deckt der Kanal Topf voll Gold auf, wie der Springer Konnzern konkret die Bild Zeitung gezielt Feindbilder aufgebaut und gezielte Kampagnen fährt, um bestimmte Personen und Gruppen medial zu vernichten in Anführungsstrichen. Anhand konkreter Beispiele zeigt der Creator, wie reißerische Überschriften und Suggestivberichte genutzt werden, um Emotionen zu schüren. Welche mechanischen Techniken wie Wiederholung, einseitige Darstellung, Dramatisierung eingesetzt werden, um Feindbilder zu manifestieren. Wie die mediale Inszenierung dadurch im öffentlichen Diskurs Empörung lenkt und die journalistische Sorgfalt verlassen wird, verlassen wird. So, da ist die Stimme auch wieder da. Ziel des Videos ist es zu sensibilisieren. Man soll Presseberichte kritisch hinterfragen, statt sie unreflektiert zu übernehmen. Schaut euch das gerne mal an. Hier gibt es auch ein Segment zur Berichterstattung über die ER Bewegung und Rudi Dutschke. Dabei geht der Macher des Videos auch darauf ein, dass Springer im Jahr 2010 alle Artikel zur Studentenbewegung veröffentlicht hat. Ja, okay, das war es jetzt auch mit diesem kleinen Diskurs und zu diesem Thema. Die Folge ist ja auch schon fast zu Ende so. Rudi Dutschke war halt vieles ein Christen, ein Sozialist, ein Intellektueller, ein Träumer. Aber er war vor allem eines ein Mensch, der an die Veränderbarkeit der Welt glaubte. Er wurde fast getötet, weil Worte ihn zur Bedrohung machten. Und genau deshalb ist seine Geschichte so wichtig. Die Frage ist Nicht, ob Bild mitgeschossen hat. Die Frage ist, wie viele Menschen braucht es die Worte ernst nehmen? Wie viele Schlagzeilen machen aus einem Gedanken ein Ziel? Dutschke sagte einmal, wir müssen lernen, ohne Angst zu leben. Aber vielleicht müssen wir auch lernen, ohne Hetze zu leben, ohne Sprachgewalt, ohne die permanente Suche nach einem Feindbild. Aber was meint ihr zu der Geschichte? Schreibt mir und teilt diese vorletzte Folge von San ins Hirn gerne und bleibt weiterhin neugierig. Bis bald. Ciao.